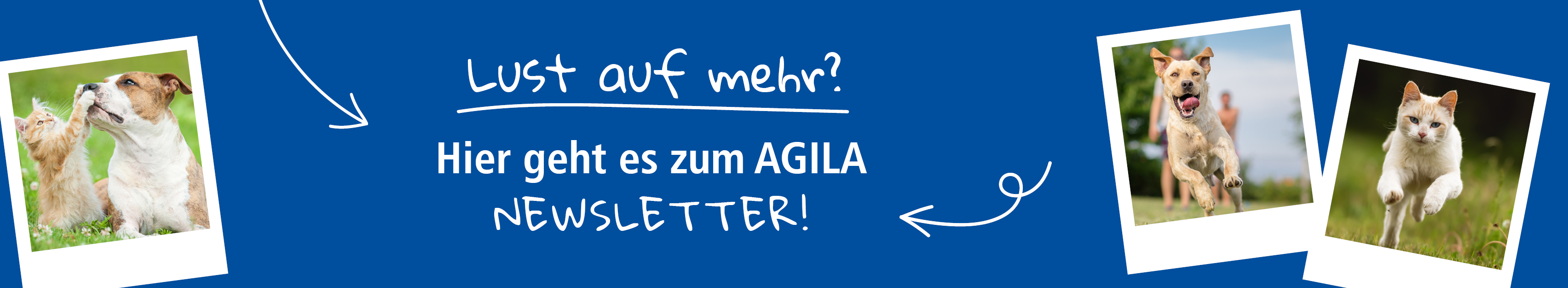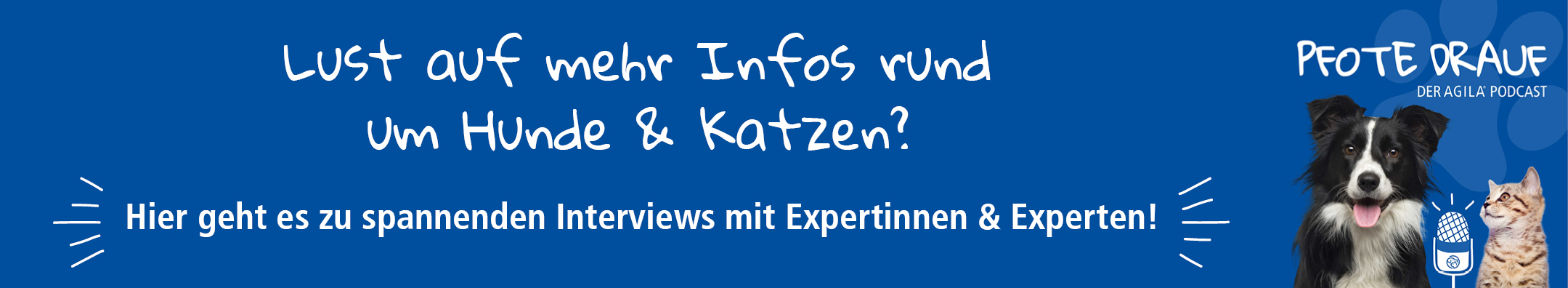Sie möchten zwei Katzen aneinander gewöhnen, wissen aber nicht, wie Sie vorgehen sollen? In diesem Artikel erfahren Sie, wie die Katzenzusammenführung gelingt, worauf Sie unbedingt achten sollten – und was zu tun ist, wenn es zwischen den Tieren nicht harmoniert.
Inhaltsverzeichnis:
- Zwei Katzen aneinander gewöhnen: Was Sie im Vorfeld tun sollten
- Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Zusammenführung von Katzen
- Warum eine Katzenzusammenführung scheitern kann
- Einzelkatze oder Mehrkatzenhaushalt: Sollte ich eine zweite Katze halten?
- Der richtige Zeitpunkt: Katzen vor oder nach der Kastration zusammenführen?
- Woran Sie erkennen, dass die Zusammenführung gescheitert ist
- Wenn sich zwei Katzen dauerhaft nicht verstehen – was tun?
Zwei Katzen aneinander gewöhnen: Was Sie im Vorfeld tun sollten
Die Frage nach einer zweiten Katze sollte gut überlegt sein – vor allem, wenn Ihre Erstkatze bisher allein gelebt hat. Damit die Katzenzusammenführung gelingt, kommt es entscheidend auf die Vorbereitung an. Denn Katzen sind sensible Tiere mit einem ausgeprägten Revierverhalten. Wird eine neue Katze einfach ins Wohnzimmer gesetzt, sind Konflikte fast vorprogrammiert.
Bevor Sie die Tiere zusammenbringen, sollten beide Katzen einem gründlichen medizinischen Check unterzogen werden. Dazu gehören Impfstatus, Parasitenkontrolle (zum Beispiel auf Würmer und Flöhe), ein allgemeiner Gesundheitscheck sowie – bei Bedarf – ein Test auf ansteckende Katzenkrankheiten wie FIV oder FeLV. So stellen Sie sicher, dass keine Infektionsgefahr besteht.
Schaffen Sie außerdem schon vor dem ersten Kennenlernen die nötigen Rückzugs- und Sicherheitszonen. Idealerweise leben die beiden Katzen in der Anfangsphase räumlich getrennt – etwa in verschiedenen Zimmern mit geschlossener Tür. So kann jede für sich ankommen und Stress abbauen.
Tipp: Reiben Sie beide Tiere mit jeweils einem eigenen weichen Tuch ab und tauschen Sie diese anschließend. So kann sich jede Katze mit dem Geruch der anderen vertraut machen – das kann die Akzeptanz bei der Zusammenführung erleichtern.
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Zusammenführung von Katzen
Eine erfolgreiche Vergesellschaftung basiert auf Geduld, Beobachtung und der richtigen Einschätzung der tierischen Persönlichkeiten. Besonders wenn die Zweitkatze deutlich jünger oder älter als die Erstkatze ist, sollten Sie Rücksicht auf unterschiedliche Bedürfnisse nehmen.
So schaffen Sie optimale Startbedingungen
Die erste Phase der Katzenzusammenführung beginnt mit räumlicher Trennung – idealerweise bekommt jede Katze ihren eigenen Raum, in dem sie sich orientieren und ankommen kann. Erster Sichtkontakt sollte zunächst nur kontrolliert erfolgen. Eine Glastür, ein Türgitter oder ein leicht geöffneter Türspalt reichen aus, um die Neugier zu wecken, ohne gleich die Sicherheitsdistanz zu verlieren.
In dieser Phase ist es sinnvoll, positive Reize mit dem Anblick oder Geruch der anderen Katze zu verknüpfen. Beispielsweise können Sie beide Tiere gleichzeitig auf ihren jeweiligen Seiten der Tür füttern. Auch gemeinsames Spielen mit zwei identischen Spielangeln – getrennt durch ein Gitter – schafft Nähe, ohne Bedrängung.
Beobachten Sie dabei aufmerksam die Körpersprache: Ein aufrechter Schwanz, langsames Blinzeln oder neugieriges Schnuppern deuten auf Interesse hin. Angelegte Ohren, ein geduckter Gang, Knurren oder Fauchen signalisieren hingegen Unbehagen. Diese Reaktionen sind in der Anfangszeit ganz normal – wichtig ist nur, dass sie mit der Zeit weniger werden.
Begegnungen sinnvoll begleiten und Konflikte vermeiden
Wenn beide Katzen über mehrere Tage hinweg bei Sichtkontakt entspannt bleiben, können Sie den ersten direkten Kontakt wagen. Dieser sollte in einem Raum stattfinden, der für keine der beiden ein Hauptrevier darstellt – also möglichst neutral ist. Begleiten Sie die Begegnung ruhig, sprechen Sie mit sanfter Stimme und lassen Sie den Katzen die Möglichkeit, sich selbst einzuschätzen.
Wichtig ist jetzt:
- Nicht eingreifen, solange keine echte Gefahr besteht: Ein kurzes Fauchen, Knurren oder gegenseitiges Fixieren gehört zur Kommunikation. Es dient der Abgrenzung und ist kein Grund zur Panik.
- Nicht mit Leckerlis oder Spielzeug bedrängen: Gemeinsame Aktivitäten sind hilfreich, aber nur dann, wenn sie freiwillig und ohne Druck stattfinden.
- Immer Flucht- und Ausweichmöglichkeiten offenlassen: Ein Kratzbaum mit erhöhter Plattform, ein Sofa, unter das man sich zurückziehen kann, oder ein offener Türspalt geben Sicherheit.
- Begegnungen zeitlich begrenzen: Lieber mehrere kurze, entspannte Treffen pro Tag als eine lange, überfordernde Konfrontation.
Achten Sie in dieser Phase darauf, ob eine der Katzen dauerhaft den Rückzug antritt, nicht mehr frisst oder sich plötzlich versteckt – das können erste Warnzeichen sein, dass die Zusammenführung zu schnell voranschreitet.
Warum eine Katzenzusammenführung scheitern kann
Die Gründe dafür, dass eine Zusammenführung scheitert oder ins Stocken gerät, sind vielfältig und oft in dem Charakter oder den Vorerfahrungen der Katzen verankert. Häufige Ursachen für Konflikte bei der Katzenzusammenführung sind:
- Ein zu schneller Ablauf: Wenn die neue Katze ohne vorherige Gewöhnung an Geruch, Sichtkontakt und räumliche Nähe auf die Erstkatze trifft, kann das schnell zu Überforderung führen. Viele Katzen erleben das als Eindringen in „ihr Revier“ – was Instinkte wie Verteidigung oder Rückzug auslöst.
- Ein unpassender Altersunterschied: Wenn ein junges, aktives Kitten auf eine ältere, ruhige Katze trifft, stoßen gegensätzliche Bedürfnisse aufeinander. Während das Kitten spielen, toben und erkunden will, sucht die ältere Katze eher Ruhe und Routine. Das führt häufig zu Missverständnissen und Frustration – auf beiden Seiten.
- Fehlende Rückzugsmöglichkeiten: Wenn Katzen keine Wahl haben, sich aus dem Weg zu gehen oder sich für eine Zeit zurückzuziehen, entsteht leicht das Gefühl von Enge und Bedrängung. Konflikte, die eigentlich vermeidbar wären, eskalieren schneller, wenn der räumliche Platz fehlt.
- Unzureichende Ressourcenverteilung: Ein häufiger, aber oft unterschätzter Auslöser für Spannungen ist das Fehlen mehrfach verfügbarer Ressourcen. Jede Katze sollte Zugang zu eigenen Futter- und Wassernäpfen, Kratzmöglichkeiten, Schlafplätzen und insbesondere zu mindestens einem eigenen (und einem geteilten) Katzenklo Wird um solche Ressourcen konkurriert, entstehen Stress und Rivalitäten.
- Schlechte Vorerfahrungen mit Artgenossen: Manche Katzen haben in ihrer Vergangenheit negative Erlebnisse gemacht – etwa durch Verletzungen oder ständigen Stress in einem früheren Mehrkatzenhaushalt. Diese Tiere reagieren oft besonders sensibel auf fremde Katzen. Diese Skepsis abzubauen, braucht viel Zeit und behutsames Vorgehen.
Natürlich lassen sich nicht alle dieser Faktoren vollständig vermeiden. Aber je bewusster Sie sich mögliche Schwierigkeiten machen, desto gezielter können Sie darauf reagieren – etwa durch längere Gewöhnungsphasen, mehr räumliche Trennung und der Auswahl einer passenden Zweitkatze.
Einzelkatze oder Mehrkatzenhaushalt: Sollte ich eine zweite Katze halten?
Katzen gelten oft als unabhängig und eigenwillig – doch sie sind keine absoluten Einzelgänger. In ihrer natürlichen Umgebung leben viele Katzen in lockeren Gruppen und suchen soziale Nähe zu vertrauten Artgenossen. Besonders Tiere, die gemeinsam aufgewachsen sind oder sich früh an andere Katzen gewöhnt haben, profitieren vom Leben im Mehrkatzenhaushalt.
Vorteile der Haltung mehrerer Katzen
Zwei Katzen, die gut miteinander auskommen, profitieren in vielerlei Hinsicht voneinander. Soziale Interaktionen wie gemeinsames Spielen, gegenseitiges Putzen oder das Ruhen in Nähe zueinander entsprechen ihrem natürlichen Verhalten und können das Wohlbefinden steigern – insbesondere in reiner Wohnungshaltung, wo Umweltreize begrenzt sind.
Ein Artgenosse bietet Möglichkeiten zur Kommunikation und Beschäftigung, die der Mensch trotz großer Zuwendung nur bedingt ersetzen kann. Katzen, die regelmäßig mit einem passenden Sozialpartner interagieren, zeigen oft ausgeglicheneres Verhalten, sind aktiver und seltener unterfordert. Das kann langfristig auch helfen, Problemen wie Verhaltensauffälligkeiten oder Bewegungsmangel vorzubeugen.
Gerade bei jungen oder gut sozialisierten Tieren ist die Chance groß, dass sie das Zusammenleben mit einer weiteren Katze als Bereicherung empfinden. Sie sind oft spielfreudig, offen für Kontakte und profitieren von einem Artgenossen, der ähnliche Bedürfnisse teilt – vorausgesetzt, die Charaktere passen zueinander.
Wann Einzelhaltung für Katzen die bessere Lösung ist
Es gibt jedoch Ausnahmen. Manche Katzen – insbesondere ältere oder traumatisierte Tiere – ziehen ein Leben allein vor. Wenn eine Katze nie gelernt hat, mit Artgenossen zu kommunizieren, oder schlechte Erfahrungen mit anderen Katzen gemacht hat, kann eine Vergesellschaftung sehr belastend sein.
Auch stark territoriale Katzen, die ihr Umfeld nicht teilen wollen, können mit einer Zweitkatze dauerhaft überfordert sein. In solchen Fällen kann Einzelhaltung die stressfreiere und damit tiergerechtere Lösung sein – vor allem, wenn sie mit viel menschlicher Zuwendung, Abwechslung und Beschäftigung ausgeglichen wird.
Wichtig ist, das Verhalten Ihrer Katze aufmerksam zu beobachten: Sucht sie Nähe, zeigt Spielverhalten, interessiert sich für andere Katzen? Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie von einem Sozialpartner profitiert. Zieht sie sich zurück, reagiert auf andere Katzen mit Aggression oder Angst, meidet Begegnungen? Dann kann ein Zusammenleben auf engem Raum zu einer dauerhaften Belastung werden.
Sind Sie sich unsicher, welche Haltungsform für Ihre Katze am besten ist, oder haben Sie Probleme bei der Katzenzusammenführung, können Sie stets Ihre Tierärztin oder Ihren Tierarzt sowie eine Katzenpsychologin oder einen Katzenpsychologen um Rat fragen.
Der richtige Zeitpunkt: Katzen vor oder nach der Kastration zusammenführen?
Ob die Katzen bereits kastriert sind oder nicht, kann einen entscheidenden Einfluss auf ihr Verhalten während der Zusammenführung haben. Unkastrierte Tiere zeigen häufig ein stärker ausgeprägtes Territorialverhalten, markieren häufiger und sind im Umgang mit Artgenossen oft angespannter oder dominanter. Diese hormonell bedingten Spannungen können das Kennenlernen erheblich erschweren.
Besonders während der Pubertät, etwa ab dem vierten bis sechsten Lebensmonat, verändern sich junge Katzen deutlich. Sie entwickeln klare Revieransprüche und testen Grenzen aus.
Werden Tiere genau in dieser Zeit erstmals miteinander konfrontiert, kommt es oft zu Konflikten, die den Start nachhaltig belasten.
Sind die Katzen kastriert, kann das bei einigen Tieren ein entspannteres Wesen begünstigen und die Zusammenführung erleichtern. Bei gemischtgeschlechtlichen Mehrkaushalten kann eine Kastration sinnvoll sein, um ungewollten Nachwuchs zu verhindern.
Woran Sie erkennen, dass die Zusammenführung gescheitert ist
Nicht jedes Fauchen oder Knurren ist ein Alarmsignal – gerade in den ersten Tagen einer Katzenzusammenführung gehört solches Verhalten zum sozialen Abtasten. Katzen verständigen sich über Körpersprache, Laute und Abstand, wobei es durchaus auch mal lauter werden kann, ohne dass ernsthafte Ablehnung vorliegt.
Problematisch wird es dann, wenn sich Spannungen nicht abbauen, sondern über Wochen hinweg bestehen bleiben oder sich sogar verschärfen. Dazu gehören dauerhaftes Verstecken, aggressives Verhalten ohne Anlass, körperliche Auseinandersetzungen mit Verletzungen und anhaltende Revierkämpfe. Zusätzliche Warnzeichen sind gesundheitliche Stresssymptome wie Durchfall, Erbrechen, Appetitlosigkeit oder übermäßiges Putzen – vor allem, wenn sie neu auftreten.
Wenn sich zwei Katzen dauerhaft nicht verstehen – was tun?
Auch bei optimalen Voraussetzungen, viel Geduld und guter Vorbereitung kann es vorkommen, dass die Katzenzusammenführung scheitert. Nicht alle Tiere harmonieren miteinander – selbst dann nicht, wenn jede Katze für sich gut sozialisiert ist. Was also tun, wenn sich zwei Katzen dauerhaft nicht verstehen?
Ein möglicher Weg ist es, das Zusammenleben räumlich zu entzerren. Durch eine klare Revieraufteilung innerhalb der Wohnung, etwa durch das dauerhafte Trennen bestimmter Räume, lassen sich viele Konflikte entschärfen. So können beide Katzen ihren Alltag ohne ständige Konfrontation gestalten. In Haushalten mit ausreichend Platz kann diese Lösung sogar langfristig funktionieren, ohne dass sich eine der beiden Tiere zurückgesetzt fühlt.
Wenn Sie die beiden Katzen nicht dauerhaft räumlich trennen möchten, kann auch gezielte Unterstützung durch verhaltenstherapeutische Begleitung hilfreich sein. Tierverhaltenstherapeutinnen und -therapeuten analysieren die Situation, erkennen wiederkehrende Muster und entwickeln individuelle Ansätze, wie sich das angespannte Verhältnis verbessern lässt.
Zeigt sich jedoch über einen längeren Zeitraum keinerlei Verbesserung und leidet eine der beiden Katzen sichtbar unter der Situation sollten Sie eine behutsame Trennung in Betracht ziehen.
Das kann bedeuten, eines der Tiere in ein passenderes Zuhause zu vermitteln, in dem es zur Ruhe kommen kann. Auch wenn dieser Schritt emotional schwerfällt: Eine gut begleitete Umplatzierung kann für beide Tiere die bessere Lösung sein, insbesondere dann, wenn sich das Zusammenleben langfristig negativ auf ihr Wohlbefinden auswirkt.