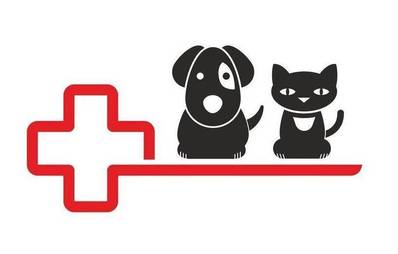- Geschrieben von
- Franziska Obert
- Veröffentlicht:
Falls Sie sich schon einmal darüber amüsiert haben, dass sich Ihr Hund auf dem Teppich oder auch auf der Wiese wälzt und sich dabei gefragt haben, was dies für eine Bedeutung hat, kommt hier die Antwort: Das ist die Art der Hunde, sich zu waschen und ihr Fell zu reinigen.
Nutzen des Fells:
- Schutz vor Kälte
- Abhalten von UV-Strahlung
- Kommunikation z.B. durch Sträuben des Fells
Hunde, die als Haustier gehalten werden, sollten deshalb je nach Verschmutzung und Geruch des Fells gewaschen werden. Für das Trocknen danach gibt es ein paar Dinge, die Sie beachten sollten.
Vorläufiges Trocken
Nach dem Waschen streichen Sie mit den Händen das überschüssige Wasser aus dem Fell. Nun reiben Sie den Hund am besten mit einem Frottiehandtuch ab und trocknen dabei auch die Ohrmuscheln. Um eine Erkältung zu vermeiden, achten Sie darauf, dass die Zimmertemperatur nicht zu niedrig ist und Ihr Hund bei kalten Außentemperaturen nicht mit nassem Fell nach draußen rennt.
Gründliche Felltrocknung
Wenn Sie Ihren Vierbeiner mit einem Haarföhn komplett trocknen möchten, sollten Sie dabei ein paar Dinge beachten. Da die meisten Hunde das laute Geräusch nicht gewohnt sind, kann es sein, dass sie zuerst davor erschrecken. Falls nötig, holen Sie sich Hilfe, um das Tier festzuhalten und zu beruhigen. Gegebenenfalls legen Sie zwischendurch kleine Pausen ein, um es nicht vollkommen zu verängstigen. Achten Sie auf eine angenehme Temperatur. Diese können Sie auch an Ihrer eigenen Hand testen. Halten Sie den Föhn ca. 30 cm vom Fell entfernt. Beginnen Sie mit dem Rücken und begeben sich immer weiter in Richtung Kopf. Schalten Sie an dieser Stelle den Föhn schwächer und verdecken die Ohren mit den Händen. Anschließend trocknen Sie die Pfoten und den Schwanz. Anstatt des Föhns kann auch ein Handtuch verwendet werden.
Im Sommer kann das Fell auch ganz einfach durch die Sonne getrocknet werden, ohne dass die Gefahr einer Erkältung oder Unterkühlung besteht. In den Wintermonaten ist auch eine warme Heizung oder ein Kaminfeuer von Nutzen. Je nach Beschaffenheit des Fells und Größe des Hundes kann abschließend noch eine Decke zum Aufwärmen verwendet werden.