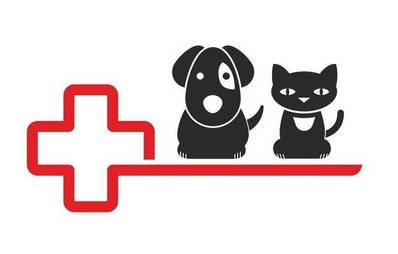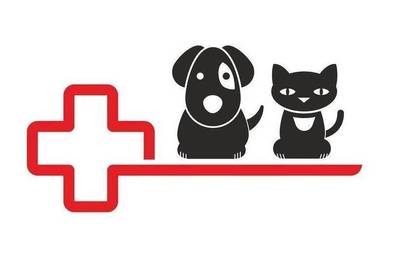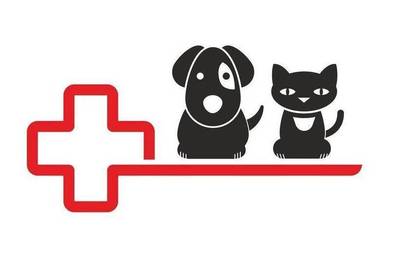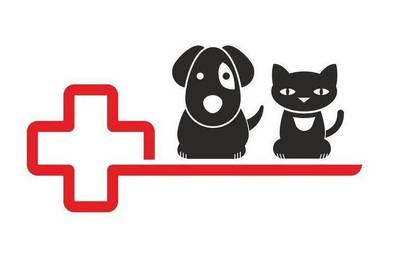- Geschrieben von
- Carolin Sieling
- Veröffentlicht:
Die kardiologische Untersuchung Ihres Hundes ist sehr wichtig, da bei Hunden besonders häufig Kardiopathien auftreten. Außerdem sollte bei jeder Untersuchung auch eine Abhörung der Herzfrequenz erfolgen, als Routinemaßnahme. Vor allem Welpen sollten entsprechend untersucht werden, um angeborene Herzfehler frühzeitig zu entdecken. Messen Sie die Herz- und Atemfrequenz Ihres Hundes regelmäßig. Auf diese Weise können Sie Ihrem Tierarzt Informationen zukommen lassen, die ihm bei der Diagnose helfen und ihn somit Abweichungen vom Normalzustand einfacher feststellen lassen. Die normale Atemfrequenz von Hunden liegt im Bereich von 10 bis 30 Atemzügen pro Minute. Erwachsene Hunde haben eine Herzfrequenz von 60 bis 120 Schlägen pro Minute, während Welpen und junge Hunde zwischen 90 und 210 Schlägen liegen. Grundsätzlich haben kleinere Rassen eine höhere Herzfrequenz als größere Rassen.
Untersuchungen im Zusammenhang mit der Herzfrequenz
Die Adspektion ist die genaue Beobachtung und äußerliche Betrachtung des Patienten. Sollte zum Beispiel eine Herzinsuffizienz vorliegen, kann sich diese durch Husten, Atemnot, verschiedene Ödeme oder Umfangszunahme des Bauchbereiches äußern. Die Palpation ist die Untersuchung Ihres Hundes durch Abtasten bestimmter Bereiche. Hierbei sollte auf jeden Fall der Puls gefühlt werden sowie der Herzspitzenstoß. Auch hier können Umfangsvermehrungen im Bauchbereich festgestellt werden. Zudem sollten Sie überprüfen, ob der Puls gleichzeitig mit dem zweiten Herzton einsetzt. Auf diese Weise können Herzrhythmusstörungen entdeckt werden. Eine Verstärkung oder Schwächung des Herzschlags decken Sie so ebenfalls auf, was ein Anzeichen für verschiedene Krankheitsbilder sein kann. Bei der Perkussion wird die Körperoberfläche abgeklopft. Damit lassen sich Krankheiten wie erhöhte Flüssigkeitsansammlungen im Brust- bzw. Bauchraum feststellen. Der wichtigste Teil der Herzuntersuchung ist allerdings die Auskultation. Dies beschreibt das Abhören der Herzgeräusche. Sie sollten immer von beiden Seiten abgehört werden und auch der Brusteingang sollte Gegenstand der Untersuchung sein. Es empfiehlt sich außerdem, einen längeren Zeitraum für das Abhören zu wählen, um kleine Abweichungen erhören zu können. Dies sind wichtigsten Parameter, die von Ihnen zu beachten sind:
- Herzfrequenz
- Herzschlagintensität: zum Beispiel Verringerung durch Adipositas oder Wasseransammlungen im Brustbereich
- Herzrhythmus
- Nebengeräusche: zum Beispiel durch Berührung des Fells oder Veränderung des umliegenden Gewebes
Visuelle Untersuchungen
Die visuelle Untersuchung des Herzens Ihres Hundes erfolgt durch Röntgen. Diese Methode kann unter anderem die Folgen einer Herzinsuffizienz aufdecken. Des Weiteren werden mitunter Ultraschalluntersuchungen oder Elektrokardiogramme angewendet, um weitere Ergebnisse zu erhalten. Das EKG eignet sich dabei besonders gut zur Feststellung von Herzrhythmusstörungen. Je nach Befund kann Ihr Tierarzt dann eine entsprechende Therapie vorbereiten. Die genannten Informationen stellen keine Anleitung zur Selbstdiagnose und Behandlung von Tierkrankheiten dar. Tierhalter sollten bei gesundheitlichen Problemen ihres Vierbeiners in jedem Fall einen Tierarzt um Rat fragen.
Die genannten Informationen stellen keine Anleitung zur Selbstdiagnose und Behandlung von Tierkrankheiten dar. Tierhaltende sollten bei gesundheitlichen Problemen ihres Tieres in jedem Fall eine Tierärztin oder einen Tierarzt um Rat fragen. Diagnosen über das Internet sind nicht möglich.