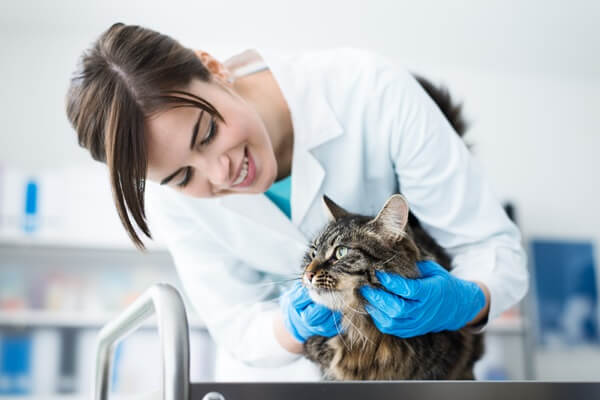Feline Infektiöse Peritonitis (FIP) ist eine durch mutierte Coronaviren ausgelöste, oft tödliche Viruserkrankung bei Katzen. Besonders junge oder immungeschwächte Tiere sind gefährdet, typische Anzeichen sind Fieber, Gewichtsverlust sowie Flüssigkeitsansammlungen im Bauch. Erfahren Sie hier mehr über Symptome, Diagnose und mögliche Therapien.
Inhaltsverzeichnis:
- Was ist FIP?
- Was sind typische Symptome und wie verläuft die Infektion?
- Unterscheidung zwischen feuchter und trockener Form
- Wie wird das FIP-Virus übertragen?
- Warum bricht die Krankheit nicht immer aus?
- Wie wird FIP diagnostiziert?
- Therapie: Welche Optionen gibt es?
- Prophylaxe: Wie kann das Infektionsrisiko minimiert werden?
- Wie kann man die betroffene Katze bestmöglich unterstützen?
- FAQ – Die häufigsten Fragen zu FIP bei Katzen
Was ist FIP?
Die Abkürzung FIP steht für Feline Infektiöse Peritonitis. Diese Katzenkrankheit gehört zu den schwersten bekannten Viruserkrankungen bei Katzen und wird durch eine Mutation des Felinen Coronavirus (FCoV), also eine Veränderung im Erbgut des Virus verursacht. Das für FIP verantwortliche Virus unterscheidet sich grundlegend vom Coronavirus des Menschen und befällt ausschließlich Katzen. Besonders häufig erkranken junge Katzen unter zwei Jahren, Tiere mit geschwächtem Immunsystem oder Katzen aus größeren Beständen wie Tierheimen und Zuchten.
In seiner ursprünglichen Form löst das Virus oft nur milde Symptome wie Schnupfen oder Durchfall bei Katzen aus oder bleibt sogar völlig unbemerkt. Erst wenn es im Körper der Katze mutiert, entwickelt sich daraus die gefährliche feline infektiöse Peritonitis (FIP bei Katzen). Bei dieser Mutation verändert sich die Gene des Virus so, dass es nicht länger nur den Darm befällt, sondern auch Immunzellen angreift und sich massiv vermehrt. Die Folge ist eine überschießende Immunreaktion, die zu schweren Entzündungen und Organschäden führt.
Was sind typische Symptome und wie verläuft die Infektion?
Die Symptome von FIP bei Katzen sind sehr vielfältig und können deshalb leicht mit anderen Krankheiten verwechselt werden. In der Regel beginnt die Erkrankung schleichend: Die Katze wirkt matt, frisst weniger und verliert langsam an Gewicht. Typisch ist ein anhaltendes beziehungsweise wiederkehrendes Fieber, das auf Antibiotikatherapien nicht anspricht.
Im weiteren Verlauf unterscheiden sich die Anzeichen je nach Form der Krankheit. Manche Katzen entwickeln eine deutliche Zunahme des Bauchumfangs durch Flüssigkeitsansammlungen in der Bauchhöhle, andere entwickeln neurologische Auffälligkeiten wie Taumeln oder Krampfanfälle, wieder andere Augenprobleme wie Trübungen oder Entzündungen.
Daneben können weitere unspezifische Beschwerden auftreten, die leicht übersehen werden:
Unterscheidung zwischen feuchter und trockener Form
FIP bei Katzen kann in zwei unterschiedlichen Formen auftreten, die sich in ihren Krankheitszeichen unterscheiden. Beide Varianten können sich im Verlauf abwechseln oder sogar gleichzeitig bestehen.
Bei der feuchten Form (exsudative Form) sammelt sich Flüssigkeit in Bauch- oder Brusthöhle. Dadurch wirkt der Bauch aufgebläht, die Atmung wird schwer und die Katze nimmt oft eine angestrengte Haltung ein, bei der Kopf und Hals nach vorne gestreckt sind. Diese Form schreitet meist schnell voran.
Die trockene Form (granulomatöse Form) hingegen verläuft ohne Flüssigkeitsansammlungen. Stattdessen bilden sich entzündliche Veränderungen in Organen wie Darm, Leber, Nieren oder Lymphknoten sowie im Nervensystem oder in den Augen. Betroffene Katzen können dadurch Bewegungsstörungen (Ataxie) Gleichgewichtsstörungen, Lähmungen, Krampfanfälle (selten) oder Sehstörungen entwickeln. Der Verlauf ist meist langsamer, aber auch schwerer zu diagnostizieren, da die Anzeichen weniger eindeutig sind.
Damit Sie die Unterschiede zwischen beiden Formen auf einen Blick erkennen können, finden Sie hier eine Übersicht:
|
Merkmal |
Feuchte Form |
Trockene Form |
|
Hauptmerkmal |
Flüssigkeit sammelt sich im Bauch oder Brustkorb |
Entzündungsherde in Organen, Augen oder Nervensystem |
|
Typische Anzeichen |
aufgeblähter Bauch, schnelle Gewichtsabnahme, Atemnot oder Hecheln |
schleichender Gewichtsverlust, Augenprobleme, neurologische Störungen (Taumeln, Krämpfe) |
|
Verlauf |
meist innerhalb von Tagen fortschreitend, deutlich sichtbar |
eher langsam, schwieriger zu erkennen |
|
Diagnose |
Flüssigkeit im Bauch oder Brustkorb erhärtet den Verdacht |
nur durch Kombination mehrerer Tests möglich |
Wie wird das FIP-Virus übertragen?
Die Ursache von FIP ist eine Mutation des Felinen Coronavirus. Dieses Virus wird hauptsächlich über den Kot ausgeschieden und verbreitet sich vor allem in Mehrkatzenhaushalten über gemeinsam genutzte Katzenklos oder Näpfe (Viren im Speichel). Nach einer Infektion besiedelt das Virus zunächst den Darm und kann von dort über Wochen oder sogar Monate wieder ausgeschieden werden.
Typische Übertragungswege sind:
- gemeinsam genutzte Katzenklos (die häufigste Infektionsquelle)
- Fell oder Pfoten, wenn Kotreste daran haften
- in seltenen Fällen auch Speichel oder Nasensekret
Wichtig: Eine Katze mit diagnostizierter FIP steckt andere Tiere in der Regel nicht direkt mit FIP an, sondern nur mit der ursprünglichen Coronavirus-Variante. Ob diese bei einer neuen Katze mutiert, hängt von deren Immunsystem und weiteren Faktoren ab.
Warum bricht die Krankheit nicht immer aus?
Nicht jede Katze, die mit dem Felinen Coronavirus infiziert ist, erkrankt auch an FIP. Tatsächlich entwickelt nur ein kleiner Teil der infizierten Tiere die Krankheit. Das liegt daran, dass das Virus zwar weit verbreitet ist, die gefährliche Mutation zum FIP-Virus jedoch nur unter bestimmten Bedingungen in dem jeweiligen Tier stattfindet. Welche Katze betroffen sein wird und welche nicht, lässt sich kaum vorhersagen – hier spielen mehrere Faktoren zusammen:
- Immunsystem: Katzen mit einer stabilen Abwehr können das Coronavirus meist in Schach halten. Ist das Immunsystem aber geschwächt, etwa durch andere Krankheiten, Medikamente oder eine generelle Abwehrschwäche, steigt die Gefahr, dass das Virus mutiert.
- Stress: Belastungen wie ein Umzug, eine neue Katze im Haushalt, Rangordnungskämpfe oder auch Operationen wirken sich negativ auf die Abwehrkräfte aus. Stress gilt als einer der häufigsten Auslöser dafür, dass das Virus kippt und FIP ausbricht.
- Alter: Besonders oft erkranken junge Katzen unter zwei Jahren. Ihr Immunsystem ist noch nicht vollständig ausgereift, sodass sie Infektionen schlechter kontrollieren können. Auch ältere Katzen, insbesondere ab etwa 15 Jahren, gelten als anfälliger.
- Genetische Faktoren: Bei einigen Rassekatzen – etwa Bengalen, Birmas oder Abessiniern – wurde beobachtet, dass FIP häufiger auftritt als bei Mischlingskatzen. Das spricht für eine mögliche erbliche Komponente, auch wenn der Zusammenhang bislang nicht eindeutig bewiesen ist.
Das bedeutet: Viele Katzen können jahrelang Coronaviren in sich tragen, ohne jemals an FIP zu erkranken. Erst wenn mehrere ungünstige Bedingungen zusammentreffen, kann das Virus mutieren und die Krankheit auslösen. Genau diese Unsicherheit macht es so schwierig vorherzusagen, ob eine Katze mit positivem Coronavirus-Test später wirklich FIP entwickelt.
Wie wird FIP diagnostiziert?
Eine FIP-Diagnose ist selten eindeutig. Es gibt keinen simplen Schnelltest, der die Krankheit bestätigt. Stattdessen müssen verschiedene Untersuchungen kombiniert werden, die zusammen ein klares Bild ergeben.
Typische Schritte der Diagnostik sind:
- Blutwerte: Im Blut zeigen sich oft auffällige Werte, zum Beispiel veränderte Proteinkonzentrationen oder das stark vermehrte Auftreten von Antikörpern. Diese Veränderungen deuten auf eine chronische Entzündung und eine gestörte Immunreaktion hin. Auch die Leberwerte oder ein Blutbild können Hinweise liefern.
- Bildgebung: Mithilfe von Ultraschall oder Röntgen lassen sich Flüssigkeitsansammlungen in Bauch- oder Brusthöhle sowie vergrößerte Organe oder Lymphknoten sichtbar machen. Besonders bei der feuchten Form kann das ein wichtiger Hinweis sein.
- Analyse von Körperflüssigkeiten: Bei Katzen mit Bauchhöhlen- oder Brusterguss wird die Flüssigkeit untersucht. Typisch für FIP ist ein strohgelber, zähflüssiger Erguss mit sehr hohem Eiweißgehalt.
- Molekulare Tests und Gewebeproben: PCR-Tests können Virusbestandteile nachweisen, sind jedoch nicht immer eindeutig, da auch gesunde Katzen positiv getestet werden können. Auch negativ ausfallende Tests sind nicht beweisend dafür, dass die Katze keine FIP-Erkrankung hat. Im fortgeschrittenen Stadium sind bisweilen keine Viren mehr nachweisbar, die überschießende Immunreaktion läuft aber von allein weiter und greift das Gewebe an.
Therapie: Welche Optionen gibt es?
Während FIP bei Katzen früher fast immer tödlich verlief, hat sich die Situation in den letzten Jahren deutlich verbessert. Durch den Einsatz neuer antiviraler Medikamente ist es heute möglich, viele erkrankte Tiere erfolgreich zu behandeln. Deren Beschaffung ist ein wenig mühsam, aber seit 2024 immerhin auch in Deutschland legal möglich.
Die Therapie bleibt jedoch anspruchsvoll. Sie muss konsequent über mehrere Wochen oder sogar Monate durchgeführt werden, und die Dosierung richtet sich individuell nach Gewicht, Krankheitsform und Verlauf. Besonders wenn die Erkrankung früh erkannt wird, sind die Heilungschancen inzwischen deutlich besser als noch vor wenigen Jahren. Auch Katzen mit neurologischen Symptomen können von der Behandlung profitieren, wenngleich die Therapie hier oft länger dauert und intensiver überwacht werden muss.
Zusätzlich zu den antiviralen Medikamenten sind unterstützende Maßnahmen wichtig, um die Lebensqualität der Katze zu sichern. Dazu gehören etwa Infusionen zur Stabilisierung, schmerzlindernde Medikamente oder auch eine angepasste Ernährung mit leicht verdaulicher, energiereicher Kost.
Tierarztkosten können in solchen Fällen schnell zur Belastung werden – etwa durch langwierige Behandlungen, Operationen oder regelmäßige Kontrollbesuche. Eine Tierkrankenversicherung bietet hier Sicherheit: Sie übernimmt im Ernstfall einen großen Teil der Kosten und stellt sicher, dass Katzen die medizinische Versorgung erhalten, die sie benötigen.
Jetzt gegen hohe Tierarztkosten absichern
Prophylaxe: Wie kann das Infektionsrisiko minimiert werden?
Eine Katzenimpfung gegen FIP existiert, wird aber nur bedingt empfohlen, da ihre Wirksamkeit nicht ausreichend belegt ist. Deshalb spielt die Vorbeugung über Hygienemaßnahmen die wichtigste Rolle.
Praktische Tipps für den Alltag:
- Saubere Katzenklos: Tägliches Reinigen senkt das Risiko der Virusübertragung.
- Ausreichend Toiletten: Mindestens eine pro Katze plus eine zusätzliche.
- Stress vermeiden: Katzen reagieren empfindlich auf Veränderungen – stabile Routinen schützen das Immunsystem. Bei unvermeidlichen Stresssituationen gibt es unterstützende Maßnahmen wie Pheromonstecker (Duftstoffe, die beruhigend wirken) oder Futtermittelergänzungsprodukte, die das Stresslevel senken.
- Neue Tiere langsam eingewöhnen: Neuzugänge vorab testen und behutsam in die Gruppe integrieren.
- Gesundheitschecks: Regelmäßige Untersuchungen bei einer Tierärztin oder einem Tierarzt helfen, Probleme früh zu erkennen
- Schmerzen machen Stress: Grunderkrankungen immer zügig behandeln lassen.
Wichtig: Wenn eine FIP-erkrankte Katze den Haushalt verlassen hat, sollte vor der Neuanschaffung eines Haustiers dringend der gesamte Wohnraum gründlich gereinigt werden. So können vorhandene Coronaviren entfernt werden. Bei bekannter Infektion mit felinen Coronaviren hilft regelmäßige Reinigung, die Virusmenge möglichst gering zu halten.
Wie kann man die betroffene Katze bestmöglich unterstützen?
Wenn bei einer Katze FIP diagnostiziert wird, ist die Sorge zunächst groß. Doch gerade in dieser schwierigen Zeit können Sie mit Ruhe, Fürsorge und kleinen Anpassungen im Alltag viel dafür tun, dass Ihre Katze sich sicher und geborgen fühlt.
Wichtig sind vor allem folgende Punkte:
- Eine stressarme Umgebung: Rückzugsmöglichkeiten, vertraute Abläufe und ein ruhiges Umfeld helfen der Katze, ihre Energie zu sparen.
- Zuwendung und Nähe: Sanfte Ansprache, vertraute Rituale und gemeinsame Ruhezeiten geben Sicherheit und können das Wohlbefinden steigern.
- Angepasste Ernährung: Kleine, leicht verdauliche Mahlzeiten sowie abwechslungsreiche Futterangebote können Appetitverlust entgegenwirken.
- Ausreichende Flüssigkeit: Trinkbrunnen oder Nassfutter fördern die Flüssigkeitsaufnahme, die gerade bei geschwächten Tieren wichtig ist.
- Laufende Beobachtung: Ein Tagebuch über Gewicht, Fressverhalten und Symptome unterstützt Tierärztinnen und Tierärzte bei der optimalen Anpassung der Therapie.
FAQ – Die häufigsten Fragen zu FIP bei Katzen
FIP (Feline Infektiöse Peritonitis) ist eine durch mutierte Coronaviren verursachte Krankheit. Viele Katzen tragen harmlose Coronaviren, erst die Mutation macht das Virus gefährlich und führt zu schweren Entzündungen im Körper.
Unbehandelt meist nur wenige Wochen bis Monate. Mit antiviralen Medikamenten können viele Katzen heute genesen – vor allem bei früher Diagnose.
Die Kosten liegen oft zwischen 2.000 und 4.000 Euro, je nach Medikament, Dosierung und Dauer. Hinzu kommen tierärztliche Untersuchungen und Bluttests.
Die Therapie basiert auf antiviralen Wirkstoffen wie GS-441524 oder Remdesivir. Ergänzend werden Symptome behandelt, etwa mit Infusionen, Schmerzmitteln oder spezieller Ernährung.
Nein, FIP selbst ist nicht direkt übertragbar. Ansteckend ist nur das ursprüngliche Coronavirus, das bei anderen Katzen ebenfalls mutieren kann.